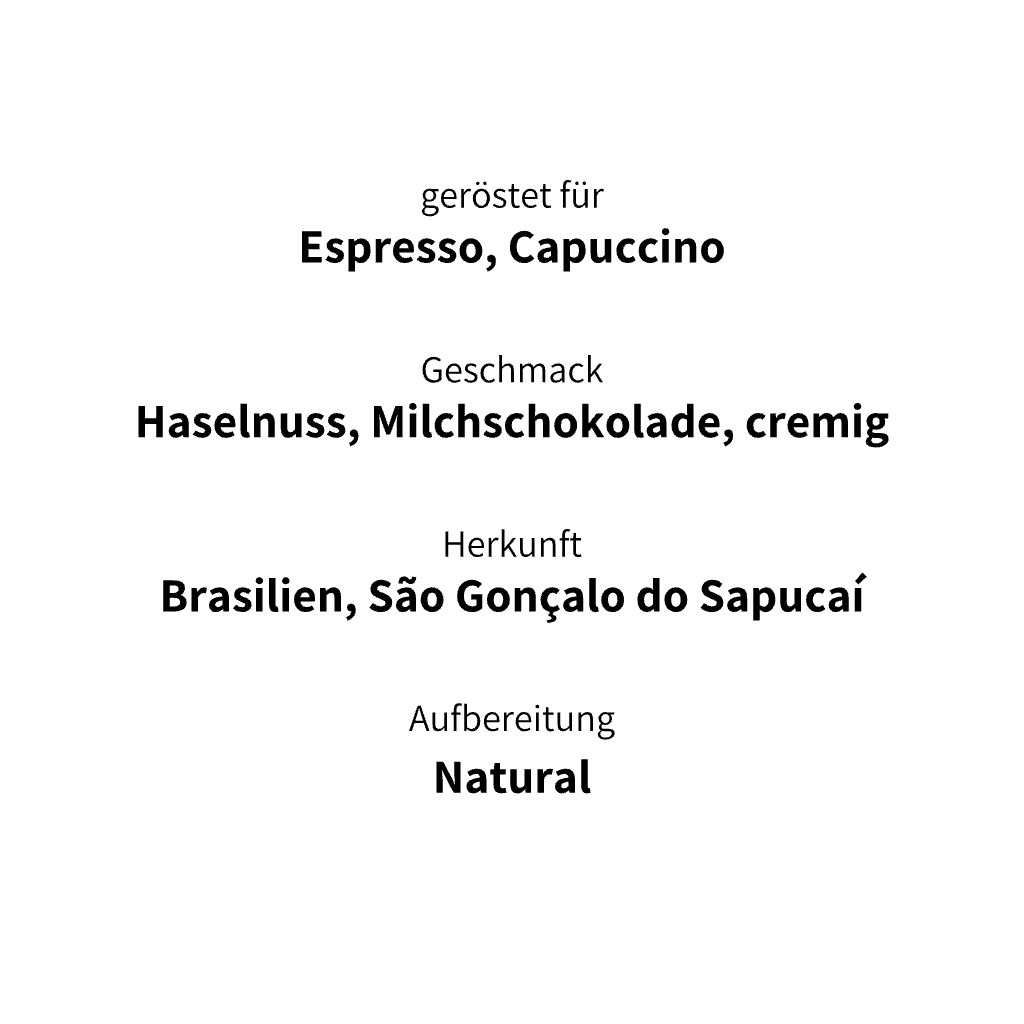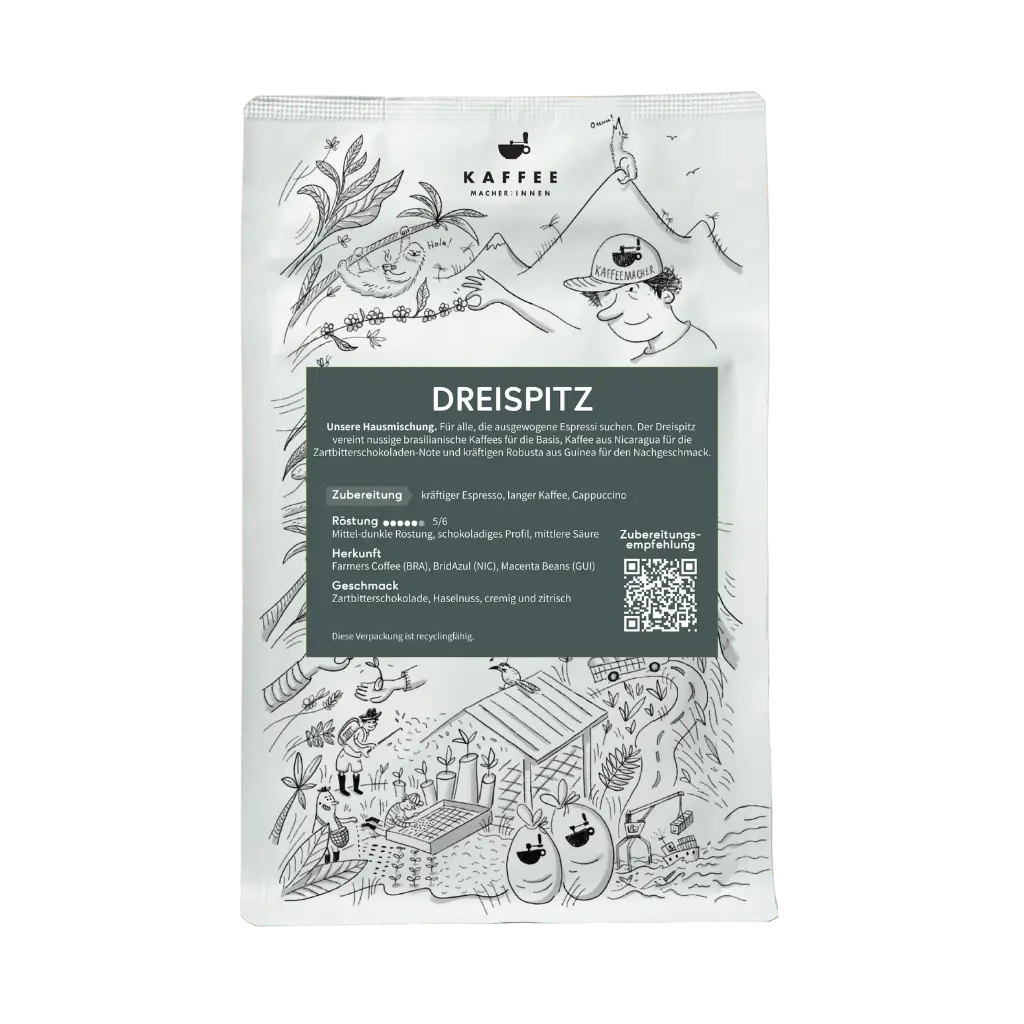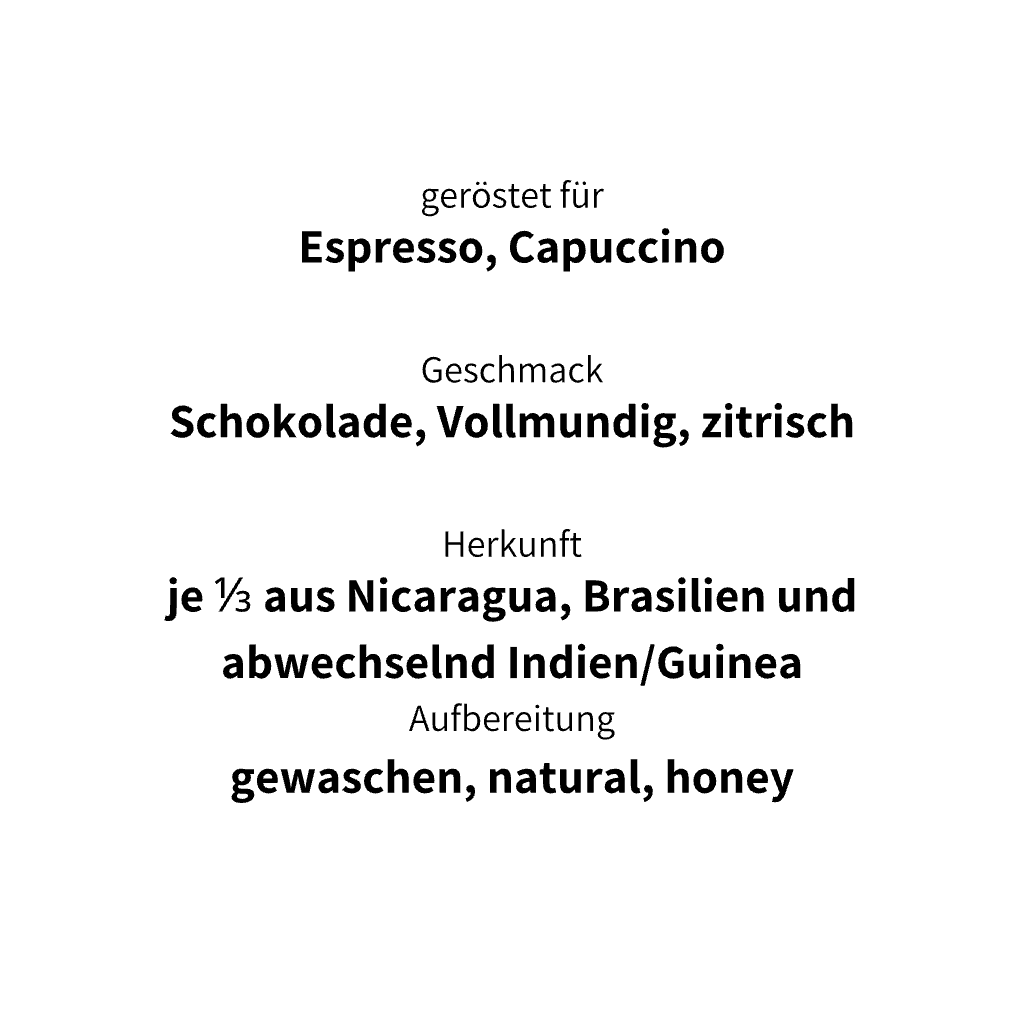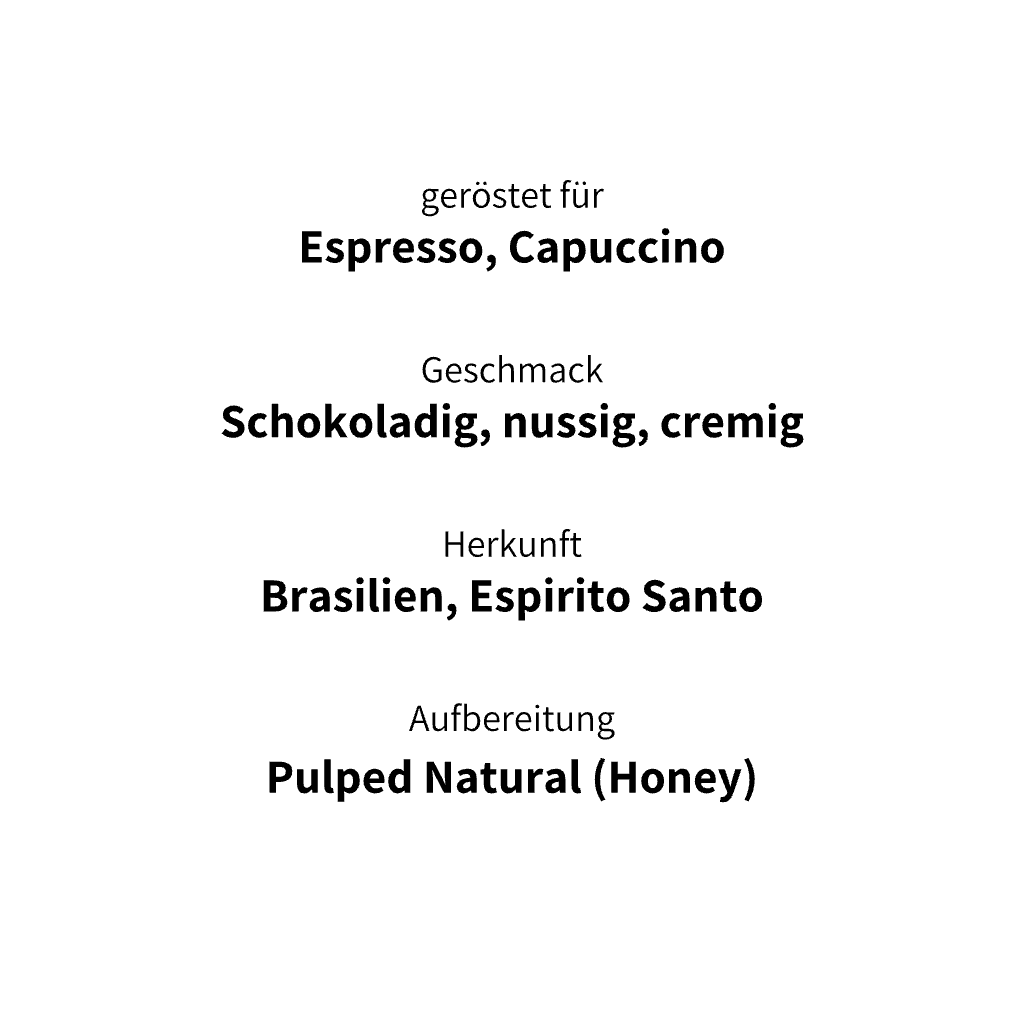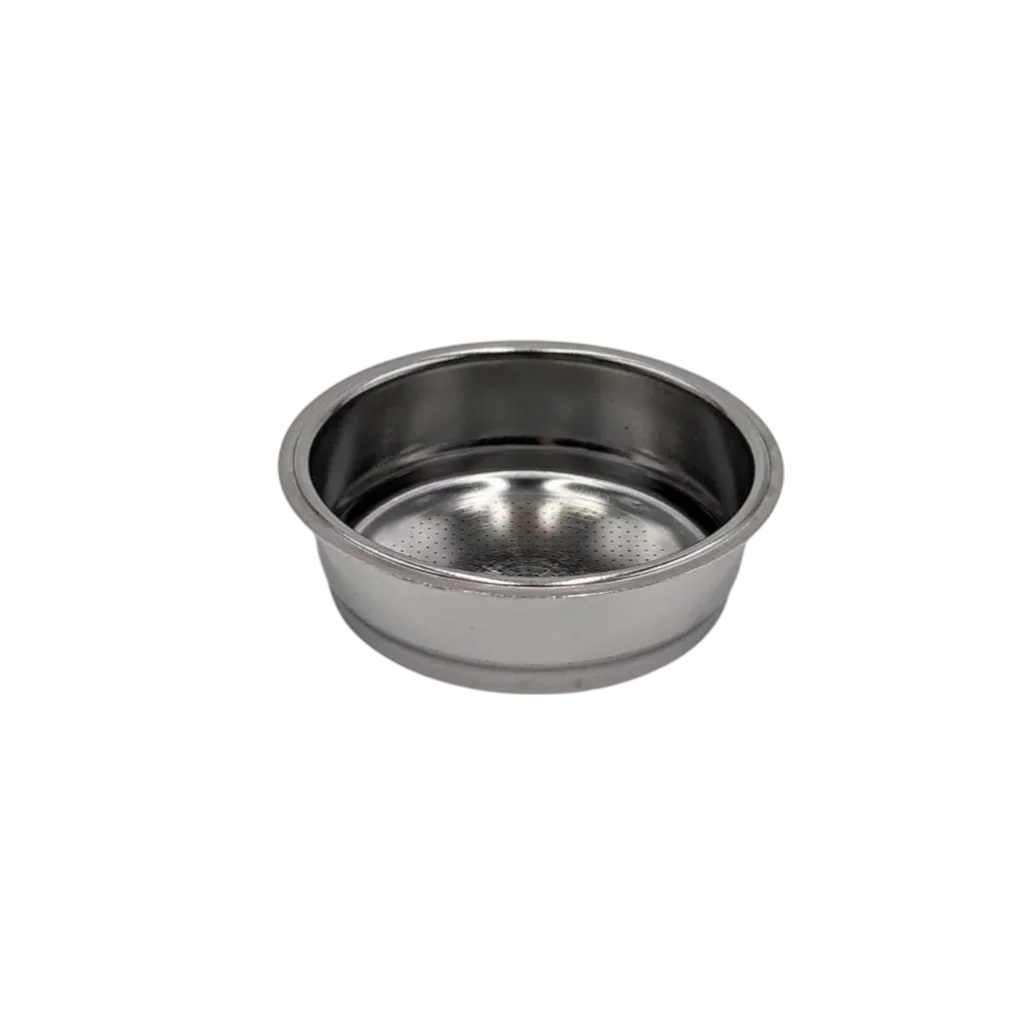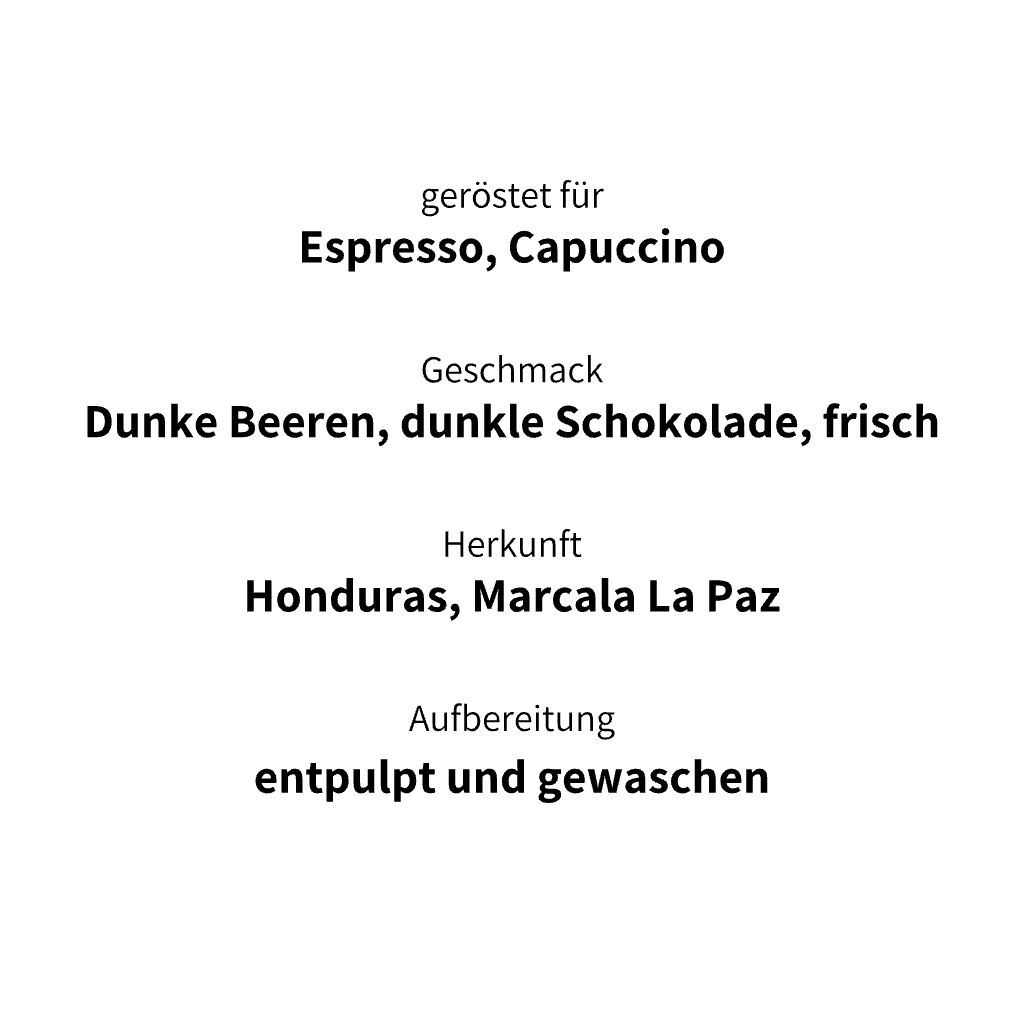Nicht jede Kaffeebohne sieht gleich aus. Das ist normal, denn es handelt sich bei Kaffee ja um ein Naturprodukt. Wir sehen verschiedene Grössen und Formen, teilweise auch Unterschiede in den Farben. Aber: Es gibt drastischere Abweichungen, die einen negativen Einfluss auf das Rösten, die Zubereitung und den Geschmack haben können. Dann reden wir von Defekten.
Einerseits unterscheiden wir zwischen Defekten, die auf der Farm oder in der Weiterverarbeitung passieren können und somit im Rohkaffee angelegt sind, und andererseits zwischen Fehlern, die beim Rösten entstehen und die sensorische Qualität des Kaffees schmälern können.
Einige mögen die Röstfehler als Stil einordnen, jedoch geht es im Grunde darum, ob das gesamte Potenzial der Bohne überhaupt abgerufen wird.
Ebenso werden Defekte nach ihrem Einfluss auf die Sensorik unterschieden. Manchmal genügt es, dass sich eine Kaffeebohne mit dem Phenol-Defekt ins Mahlgut verirrt. Diese einzelne Bohne kann dann den ganzen Geschmack einer Kaffeetasse übertünchen und ungenießbar machen. Defekte, die einen derart starken Effekt auf die Sensorik haben, werden der ersten Kategorie von Defekten zugeordnet.

Pilzbefall. Diese Bohnen werden vor dem Export aussortiert
Defekte der zweiten Kategorie beinhalten Bohnen, die allein keinen direkten Einfluss auf eine einzelne Tasse Kaffee haben. Oft sind es physisch nicht mehr intakte Bohnen wie zum Beispiel shells oder ears, auf die eine Röstung stärkeren Einfluss hat und bei denen die Röstnoten dominieren.
Was nicht zu den Defekten zählt, sind Bohnen, die optisch nicht perfekt sind, aber sonst keine weiteren Unregelmäßigkeiten aufzeigen. Oder wie eine Kollegin mal meinte:
“Ugly is not a defect.”
Ich habe einige Jahre die Röstweltmeisterschaften mitjuriert. Eine Teilaufgabe des Wettbewerbs ist das Sortieren von Rohkaffee und die Klassifizierung von Defekten, die meistens manuell in ein Muster gemischt werden. Viele Teilnehmer haben die Rohkaffees derart präzise – oder eben überpräzise – sortiert, dass viele Rohkaffees danach optisch einwandfrei aussahen, die aussortierten Bohnen aber gar keinen Defekt hatten, sondern einfach nicht der Norm entsprachen.
Sortieren bei der Dry Mill
Rohkaffees so zu sortieren, dass sie fehlerfrei und weitestgehend uniform sind, ist die Aufgabe der Dry Mill – also dem Ort, wo Kaffee exportfähig gemacht wird. Händler und Röstereien können dann aus verschiedenen Qualitäten auswählen: Röstereien, bei denen der Geschmack im Vordergrund steht, kaufen in aller Regel Kaffees ohne Defekte der ersten Kategorie ein. Marken, die primär niedrige Preise im Sinn haben, kaufen günstigeren Kaffee – und damit Kaffees mit Defekten.

Hier wird Kaffee im Parchment auf der Farm von Hand sortiert
Einige dieser Defekte kann man auch noch im Röstkaffee erkennen. Schauen wir also mal auf die Defekte der ersten und zweiten Kategorie und besprechen, wie gross ihr Einfluss auf den Geschmack ist.
Kaffee-Defekte und ihr Einfluss auf den Geschmack
Im Folgenden unterscheiden wir, wo Defekte entstehen können und wie groß ihr Einfluss auf den Geschmack sein kann. Da manche Defekte sowohl im Roh- als auch im Röstkaffee erkennbar sind, könnt ihr das zu Hause nachprüfen und eine Tüte Kaffee auf Defekte untersuchen.
Phenol
Phenol erkennt ihr an einem scharfen, medizinischen Geruch, der oft an Leder, Verbandsmaterial oder Gummi erinnert. Er entsteht hauptsächlich durch unkontrollierte Fermentation oder das Eindringen unerwünschter Mikroorganismen während der Verarbeitung. Traditionellerweise verwenden zahlreiche Röstereien im Balkan und in Osteuropa Kaffeebohnen mit geringem bis teilweise starkem Phenolanteil.
In vielen klassischen „türkischen Kaffees“ gehört Phenol zum Geschmacksbild. Was also professionell als Defekt eingestuft wird, ist für die einen ein Makel, für die anderen Teil des Gesamteindrucks. Aus Brasilien können Kaffees mit verschiedenen Phenol-Intensitäten gekauft werden: von der sanften, leicht unsauberen Phenol-Tasse bis zum stark spürbaren Phenol-Defekt, der die Tasse dominiert.
- Ursprung: unkontrollierte Femrenation, schlechte Lagerung
- optisch erkennbar: nein
- röstet sich anders: nein
- negativer sensorischer Einfluss: weniger bis sehr stark
Quaker

Eine unreife Bohne, die im gerösteten Zustand als Quaker, als helle Bohne, auftaucht
Quaker sind oft leichtere Bohnen mit geringer Dichte oder solche, die zwar eine hohe Dichte haben, aber nicht alle Nährstoffe abbekommen haben. Quaker erscheinen im Rohkaffee schon verblasst, im Röstkaffee dann gelblich bis hellbraun. Ihnen zugrunde liegt ein Mangel an Nährstoffen. In Waschkanälen können sie schon auf der Farm separiert werden, da diese floater obenaufschwimmen.
Später, kurz vor dem Export, wird der Rohkaffee in der Dry Mill geschält und klassifiziert. Auf Rütteltischen wird der Kaffee nochmals nach Dichte sortiert. Floater, oder eben dann Quaker, können hier von dichteren Bohnen separiert werden. Und dennoch schaffen es immer wieder ein paar Quaker bis ins finale Produkt.
Optisch sind die Quaker gut zu erkennen, weil sie deutlich heller als intakte Röstkaffeebohnen sind. Sensorisch kann der Einfluss auf die Tassenqualität variieren: Sie können den Kaffeegeschmack verdünnen, ihn undefiniert nussig – häufig erdnussig – verändern. Zudem kann eine hohe Anzahl Quaker ein trockenes Mundgefühl hervorrufen.
- Ursprung: Nährstoffmangel
- optisch erkennbar: ja
- röstet sich anders: ja
- negativer sensorischer Einfluss: kaum bis mittel
Insektenbefall / Broca

Broca - von zwei Einstichen bis zum totalen Befall
Der Kaffeekirschenbohrer (Broca-Käfer) befällt die Kirschen, während sie noch am Baum sind. Er gräbt sich in die Kirsche hinein, der Eintrittspunkt ist meistens das dem Stängel gegenüberliegende Ende. Mit ihrem Legestachel (Ovipositor) legt das Insekt über 20 Tage bis zu drei Eier pro Tag. Nach einer Ruhezeit startet der Vorgang erneut. Bis zu 120 Eier werden auf diese Art und Weise von einer weiblichen Kaffeebohrerin gelegt.
Befallene Bohnen sind von Tunneln durchbohrt, werden anfällig für unkontrollierte Fermentation, Sporenbefall und verlieren an Dichte. Diese Bohnen werden vor dem Export aussortiert. Die Löcher sind in der Bohne optisch erkennbar und zeugen vom Befall. Geschmacklich haben wenige Löcher keinen großen Einfluss, solange die Bohne nicht von anderen Mikroorganismen befallen wurde. Ab vier Löchern pro Bohne spricht man von starkem Befall und nach dem früheren Q-Grade-Standard von einem schweren Defekt, den man schmecken könnte.
- Ursprung: Kaffeekirschenbohrer-Käfer
- optisch erkennbar: ja
- röstet sich anders: wenig
- negativer sensorischer Einfluss: von wenig bis stark
Shells, Ears, gequetschte Bohnen

Die Schalen, Ohren, gequetschten oder gespreizten Bohnen haben ihren Ursprung beim Entpulpen der Kaffeekirsche. Wenn die Kalibrierung der Maschine schlecht eingestellt ist, können die Scheiben die noch sehr feuchte Bohne zerquetschen oder auseinanderdrücken. Diese „gespaltenen“ Bohnen werden vor dem Export aussortiert, schaffen es aber auch immer wieder ins finale Produkt.
Da diese Bohnen nicht mehr intakt sind und eine deutlich geringere Dichte haben, lassen sie sich ganz anders rösten. Sie verbrennen schneller und werden kohlig bis aschig.
- Ursprung: Entpulpen der Kaffeekirschen
- optisch erkennbar: ja
- röstet sich anders: ja
- negativer sensorischer Einfluss: mittel bis stark
Wenig Uniformität
Kaffeebohnen sehen nicht alle gleich aus – weil es Kaffeebohnen sind. Was bei der Röstung hilft, sind möglichst einheitliche screen sizes, also Grössen der Bohnen.
Wenn man ganz kleine und ganz große Bohnen zusammen röstet, findet die Hitzeübertragung äußerst unterschiedlich statt: Bei der kleinen Bohne dringt die Hitze schneller in den Kern vor, während die große Bohne innen noch kaum erwärmt ist.
Möglichst einheitliche Größen der Bohnen ergeben ein einheitliches Geschmacksbild, weil sie sich gleichmäßiger im Röster verhalten.
Gebrochene Bohnen
Schon getrocknete Rohkaffeebohnen können auch während des Transports brechen – meist in kleinere Teile, weil sie schon trocken sind und nicht wie Schalen noch Feuchtigkeit enthalten. Die abgebrochenen Splitter rösten sich schnell und werden kohlig und aschig.
Defekte, die in der Rösterei entstehen
Offiziell gelten die folgenden „Defekte“ als Fehler, manche mögen sie als Stil kategorisieren. Jedenfalls können sie einen geringen bis starken Einfluss auf den Geschmack haben. Ob das zum Charakter des Kaffees positiv beiträgt oder nicht, bleibt eine individuelle Entscheidung.
Ölige Bohnen

Sehr hohe Endtemperaturen führen dazu, dass Kaffee immer dunkler wird. Die Zellen zerbersten und die Kaffeebohne wird poröser. Das sich in der Bohne befindende Öl trifft bei der Ausgasung auf weniger Widerstand und wird nach aussen gedrückt, sodass sich an der Oberfläche eine ölige Schicht ablegt.
Das Problem mit Öl ist, dass es irgendwann ranzig wird – so auch beim Kaffeeöl. Wir vermeiden stark ölige Kaffees, weil sie auch die Mühlen und Vollautomaten unnötig verschmutzen.
Tipping und Scorching
Zwei weitere Folgen, wenn sehr heiß geröstet wird – aber diesmal auf unterschiedliche Weise:
Tipping:
Besonders in industriellen Heissluftröstern, wo die Bohnen regelrecht im heißen Luftstrom durchschießen, resultiert oft ein Spitzbrand, das sogenannte Tipping. Dort, wo die Bohne am schwächsten ist – an den beiden Enden, weil sich dort das erhitzte Wasser hinverdrängt und entweicht. Gut sichtbar ist das an einem kleinen schwarzen Punkt: dem Embryo. Schnelle, heiße Röstungen können dazu führen, dass es Tipping gibt. In sehr hellen Röstungen kann Tipping sensorisch festgestellt werden – vielleicht weniger wegen des verbrannten Embryos, sondern wegen des sehr schnellen Temperaturanstiegs, der die Entwicklung anderer Aromatik verhindert.
Scorching:

Scorching entsteht, wenn eine Bohne zu lange an der sehr heißen Trommelwand liegt. Dies kann bei langsamen Drehzahlen der Trommel oder vollen Chargen passieren. Intensives Scorching resultiert in einem röstigen, aschigen Schimmer in der Kaffeetasse.
Kontextualisierung: sind wir alle zu penibel?
Kaffee ist ein Naturprodukt und deswegen sind optische Unterschiede der Bohnen eine Tatsache. Es gibt Kaffees, die in ihrem Erscheinungsbild nicht uniform sind, im Geschmack aber überzeugen. Es gibt ebenso Kaffees, die uniform sind, aber in der Qualität abfallen. Das optische Gutachten der Defekte hilft vor allem, eine Einschätzung über die Machart des Kaffees zu erlangen:
- Wo könnte nachgebessert werden?
- Welcher Schädling breitet sich gerade auf der Farm aus?
- Und sind der Entpulper sowie der Rütteltisch präzise kalibriert?
Ein Defekt, der sich wegen veränderter Wettermuster in Zukunft noch stärker zeigen wird, ist die Quaker-Bohne: die helle Bohne, die oft nach Erdnüssen riecht. Wenn diese nicht im Rohkaffee aussortiert wird, kann sie nach dem Rösten, wo sie optisch deutlich sichtbarer wird, separiert werden. In den letzten Jahren haben Röstereien dafür aufgerüstet und sogenannte Color Sorter installiert – Sortiermaschinen, die per Luftstoss gezielt Bohnen nach Farbe oder Form aussortieren.
Diese Color Sorter sind hilfreich, reduzieren die Ungleichheiten, aber auch das Volumen. Wenn ich die Maschine so einstelle, dass sie drei Prozent aller Bohnen rausnehmen soll, ich jährlich beispielsweise 100 Tonnen Kaffee röste, wären das also drei Tonnen Ausschuss pro Jahr.
Bei einem Rohkaffee-Kilopreis von 10 CHF wären das 30.000 CHF, die man für Kaffee bezahlt, ihn dann aber nicht verwendet. Es ist also auch ein ökonomischer Faktor, ob und wie stark aussortiert wird.
Und dann sehe ich die Tendenz, dass manchmal etwas zu genau hingeschaut wird: Es gibt Röstereien, die jede noch so kleine Farbveränderung aussortieren. Das ist in einem Boutique-Markt interessant, und wer für makellose Bohnen mehr bezahlen möchte, kann das tun.
Allerdings darf es dadurch nicht zu einer übersteigerten Erwartung kommen. Nur weil eine Bohne nicht „perfekt“ aussieht, ist sie nicht schlecht. Mich erinnert das an die Zeit, als ich mit hartgesottenen Q-Gradern Kaffees verkostet habe, die dann einen 79-Punkte-Kaffee zerpflückt haben, weil er nicht top war.
Aber es gibt eine große Welt zwischen Ausschussware und Boutique-Kaffees. Da hilft es manchmal, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen – oder noch wichtiger: seinem Gaumen zu vertrauen.
Reality Check auf der Kaffeefarm
Zu guter Letzt gibt es noch die Realität auf der Kaffeefarm. Im Abenteuer-Filter-Abo präsentieren wir monatlich spezielle, seltene Kaffees – immer wieder auch kleinste Lots von einzelnen Produzenten. Diese Kaffees sind in der Regel nie „perfekt“ sortiert, weil es nicht mehr Kaffee gibt.
Wenn eine Produzentin 500 kg Kaffee produziert, wird sie kaum in fünf verschiedene Größen unterteilen und dann fünf einzelne Mini-Lots von je 100 kg verkaufen. Dafür findet sich schlicht kein Markt. Also mischt sie all ihren Kaffee und nimmt vielleicht die kleinsten und größten fünf Prozent weg, was bereits etwas mehr Uniformität gibt.
Und dann kommt es eben auch darauf an, wie eine Rösterei mit diesen Bohnen umgeht. Ich liebe es, super sortierte Bohnen zu rösten. Aber wenn es sie einmal nicht gibt, dann stellen wir das Röstprofil etwas um, rösten etwas länger – und kommen zu den gewünschten Ergebnissen.
Es lohnt sich also bei allen Defekten im Kaffee, zweimal hinzuschauen.